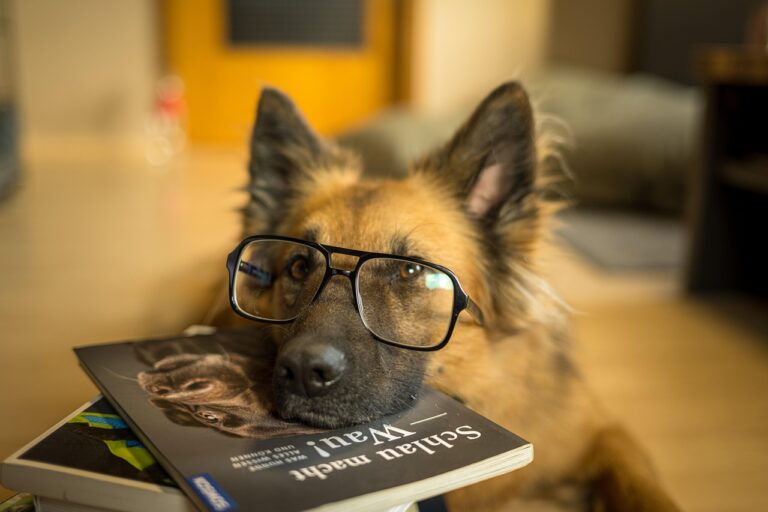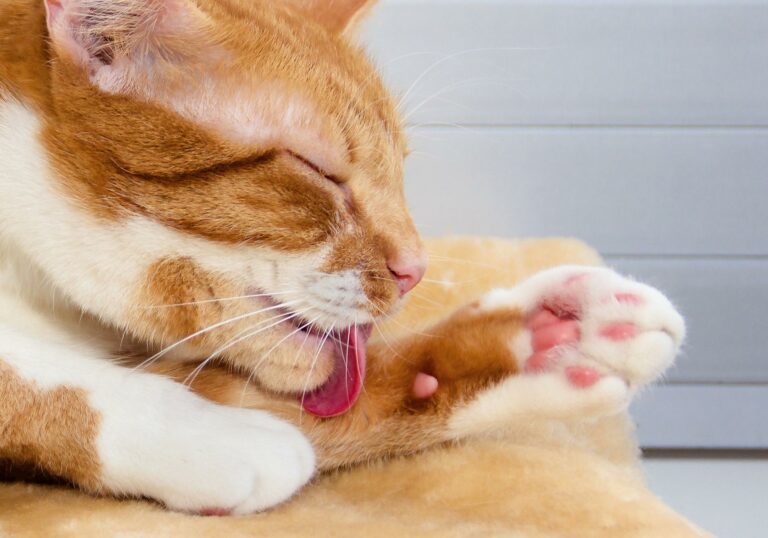Das Anweiden, der Gewöhnung an das grüne saftige Gras, ist in vollem Gang. Die Koppelzeit ist für Mensch und Pferd die schönste Zeit im Jahr.
Im 1. Teil haben sie einiges über die Entstehung der gefürchteten Hufrehe erfahren. Sie wissen auf welche Symptome sie bei ihrem Pferd achten müssen und können Erste Hilfe leisten bis der Tierarzt kommt.
Damit ihr Pferd erst gar nicht erkrankt oder einen weiteren Hufreheschub erleidet, sollten sie jetzt schon einiges tun und Vorsorge leisten.
Richtiges Anweiden
Auch wenn die Zeit im Frühjahr verlockend ist, starten sie so spät wie möglich mit dem Anweiden. Das Graswachstum und -beschaffenheit kann je nach Witterung und Region ganz unterschiedlich sein. Im Frühjahr und in den Herbstmonaten ist das Gras gestresst und hat hohe Fruktangehalte (langkettige Zuckerverbindungen). Bei bestimmten Wetterverhältnissen (Licht, Temperatur, Feuchtigkeit) wird die durch Photosynthese gewonnene Energie nicht immer zum Wachsen verbraucht, sondern kann auch in Form von Fruktan in den Pflanzen eingespeichert werden. Dabei führen höhere Temperaturen zu niedrigen und niedrige Temperaturen zu höheren Fruktangehalten im Gras.
Richtiges Anweiden und wie es funktioniert: hier weiterlesen.
Futter & Hufrehe – wo ist der Zusammenhang?
Nicht immer ist die Fütterung ausschlaggebend für eine Erkrankung, doch sie hat einen entscheidenden Einfluss auf die inneren Vorgänge und kann darüber entscheiden, ob ein Pferd erkrankt oder ob es gute Voraussetzungen mitbringt, keine Hufrehe zu erleiden.
Für den Pferddarm ist ungeeignetes Futter eine hohe Belastung. Bereits geringe Mengen können den Darm völlig aus dem Gleichgewicht bringen, dass das Milieu verschieben und den Darm „umkippen“ lassen. Gelangen unabgebaute Anteile von Eiweißen und Kohlenhydraten (Zucker, Stärke, Fruktan) in den Dickdarm, sinkt der pH-Wert stark ab – der Darmbrei wird sauer und führt u. a. zum Anstieg des Blutzuckerspiegels.
Das saure Darmmilieu lässt eine Vielzahl guter Bakterien absterben. Es bilden sich Endotoxine (Giftstoffe), die wiederum über das Blut in die feinsten Blutgefäße der Huflederhaut gelangen. Es wird vermutet, dass diese Giftstoffe oder der erhöhte Insulinspiegel zu Entzündungen bzw. Durchblutungsstörungen in der Huflederhaut führen und die schmerzhafte Rehe entstehen lassen.
Schmerzen und ihre Schutzfunktion
Schmerz ist ein Symptom und übernimmt eine wichtige Schutzfunktion, indem er den Körper vor schädlichen oder gefährlichen Einflüssen bewahrt. Unterdrückt oder nimmt man den Schmerz, so geht diese wichtige Warnfunktion verloren und der Organismus wird eventuell überlastet. Andererseits kann es entscheidend sein den Schmerzkreislauf zu unterbrechen, damit der Körper wieder seine normale Funktion wahrnehmen kann.
Grundsätzlich gilt, dass sie als Tierbesitzer zusammen mit ihrem Therapeuten individuell abwägen, ob und wie weit sie ihrem Tier den Schmerz nehmen.
Gehört ihr Pferd zur Risikogruppe?
Orientieren sie sich an den Befindlichkeiten ihres Pferdes, auch wenn das bedeutet kann, dass sie es nicht mehr auf die Weide schicken können. Gerade Pferde die bereits eine Hufrehe hinter sich haben oder an einer hormonellen Krankheit, wie dem Equine Metabolisches Syndrom (EMS) oder Equines Cushing Syndrom (ECS) leiden, sind stark gefährdet und sollten kein Gras fressen. Aber auch Allergiker, übergewichtige, stoffwechsellabile bzw. lungenkranke Pferde und die mit Verdauungsproblemen, wie Kotwasser, Durchfall oder Kolikneigung gehören ebenfalls zur Risikogruppe.
Vorbeugen ist besser als Heilen
Wenn ihr Pferd zur Risikogruppe gehört, dann sollten sie vorbeugen und versuchen folgende Dinge umzusetzen:
✔ sichern sie den Futterbedarf über spätgeschnittenes Heu bester Qualität, wenn möglich auch gewaschen, einem gewissen Anteil Stroh und einem hochwertigen Mineralfutter ohne unnötige Zusätze
✔ füttern sie keine silierten Futtermittel, wie Heulage oder Silage – dies führt zu einer weiteren Verschiebung des pH-Wertes im Darm und Blut
✔ füttern sie kein Kraftfutter, zuckerhaltige oder kohlehydrathaltige Futtermittel, wie Äpfel, Karotten, Brot, Leckerlies, usw. – die meisten Pferde kommen sehr gut nur mit Heu und einem passenden Mineralfutter aus
✔ vermeiden sie zu schnelles und frühes Anweiden, um die Aufnahme von fruktanhaltigem Gras einzugrenzen – das Ende der Löwenzahnblüte kann eine Orientierung sein, entscheiden sie aber individuell für ihr Pferd und je nach Grasvegetation bzw. -beschaffenheit
✔ reduzieren sie die Grasaufnahme durch portioniertes Weiden oder verzichten sie ganz darauf – auch Pferde ohne permanenten Zugang zu Gras haben ein erfülltes und glückliches Leben, ein weiterer Pferdepartner auf einem abgesteckten Auslauf mit Heu und Wasser vertreibt mögliche Langeweile und schafft Abwechslung
Wenn ihr Pferd nicht zur Risikogruppe gehört,
✔ checken sie ihre Weide regelmäßig auf Giftpflanzen
✔ sorgen sie für eine angepasste Fütterung bzw. Bewegung und
✔ versuchen sie Einfluss auf das Gewicht zu nehmen, um zu viele Kilos zu vermeiden
Sie können ihr Pferd gut auf die „grüne Zeit“ vorbereiten. Lassen sie sich individuell auf ihr Pferd abgestimmt Heilkräuter für Leber und Niere, die Durchblutung und Schmerzreduzierung zusammenstellen.
Unterstützen sie weiter eine gesunde und stabile Verdauung mit Effektiven Mikroorganismen (EM). Sie leisten eine gute Hilfe in Belastungszeiten und können Problematiken bei Futterumstellungen, besonders in der Anweidephase entschärfen.
Sie brauchen Unterstützung?
Ich helfe weiter. Wir analysieren gemeinsam die Lage, durchforsten die Umstände und machen uns auf die Suche nach möglichen Faktoren. Anschließend gebe ich ihnen direkte Hilfestellung.
Nutzen sie die Möglichkeit ihres ersten kostenfreien Telefongesprächs.